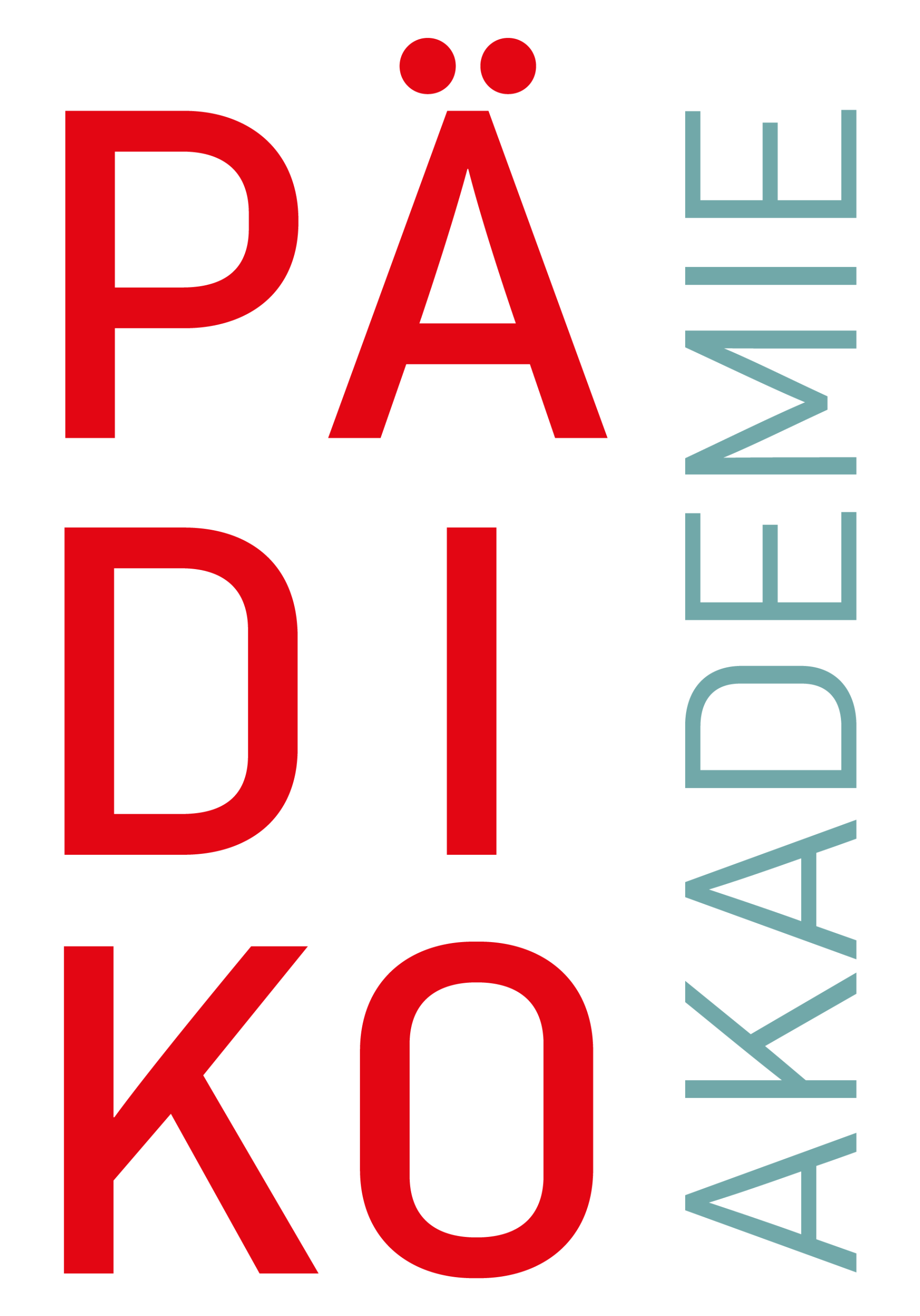Jan 22
Bewegung - Die erste Sprache des Kindes
Ein Artikel von Annemarie Rasche
Write your awesome label here.
Eine wesentliche Fähigkeit des Menschen, seine Gedanken und Gefühle auszudrücken, ist die Sprache. Sie dient dazu, mit der Umwelt in Beziehung zu treten. Dabei gilt laut Renate Zimmer, Erziehungswissenschaftlerin und Professorin für Sportwissenschaft, dass die kindliche Entwicklung und damit auch der Spracherwerb vom ersten Lebensjahr an durch Bewegung angetrieben wird. Bewegung ist ein zentrales Ausdrucksmittel des Kindes. Bevor das Kleinkind die Fähigkeit hat, zu sprechen, kommuniziert es mit Lauten, Gesten, Mimik und dem eigenen Körper. Die Entwicklung ist in den frühen Lebensjahren ein Prozess, der durch die aktive Aneignung der Welt mit allen Sinnen gekennzeichnet und eng mit den sozialen Interaktionen des Kindes mit seiner Umwelt verbunden ist.1
Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass die sprachliche Entwicklung eines Kindes nicht isoliert von anderen Prozessen betrachtet werden kann, sondern parallel zu sensorischen, motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklungsprozessen verläuft. Somit ist Bewegung ein wichtiges Mittel zur Erfahrung und Aneignung der Lebenswirklichkeit und bietet vielfältige Chancen für eine ganzheitliche Bildung. „Bewegungserziehung ist in diesem Sinne nicht nur Körper- und Bewegungserziehung, sie ist auch Erziehung und Bildung durch Körper und Bewegung“, so Erziehungswissenschaftlerin und Professorin für Sportwissenschaft Renate Zimmer.
Kinder haben intuitiv einen enormen Bewegungsdrang. Ein Spaziergang mit Kindern kann zu einem Abenteuer werden, bei dem sie ihr Bewegungs- und Gleichgewichtsrepertoire erweitern können: Hüpfen, springen, auf Bordsteinkanten balancieren, Räder schlagen und auf Bäume klettern. Kinder wollen in Bewegung sein und drücken sich über ihren Körper aus. „Ein Kind, dass sich über sich selbst und seine eigenen Bewegungsleistungen begeistert, wird sich über alles begeistern können, denn es hat die Erfahrung gemacht, dass es jeden Tag ein Stück über sich hinausgewachsen ist“, so der Neurobiologe Gerald Hüther. Bewegung ist somit eine zentrale Grundlage für die (Gehirn-)Entwicklung.
Die ersten Leistungen eines Kindes sind körperliche Leistungen, die mit Bewegung verbunden sind.2 Hier erlebt sich das Kind als Urheber seines Handelns und erfährt Selbstwirksamkeit: Es lernt, sich umzudrehen, zu gehen und zu greifen und darüber zu begreifen. Nach der englischen Psychologin Sally Goddard Blythe lautet das ABC der Kindheit: „Aufmerksamkeit, Gleichgewicht und Koordination.“ Diese Kompetenzen bilden die Basis, auf der alles weitere Lernen aufbaut.3
Im heutigen Bildungssystem liegt der Schwerpunkt jedoch überwiegend isoliert auf der Vermittlung von Fachkompetenzen. Es werden vor allem spezifische kognitive Fähigkeiten wie Mathematik, Schreiben und Sprache vermittelt. Dabei sind Lernen, Sprechen und Verhalten grundlegend mit Funktionen des Bewegungssystems und der Bewegungskontrolle verbunden. Laut der amerikanischen Entwicklungspsychologin Anna Jean Ayres sind sensomotorische Fähigkeiten die Grundlage des Lernens.4
Bewegung, und damit zusammenhängend die Ausbildung eines sicheren Gleichgewichtssystems, ist eine wesentliche Grundlage kognitiver und damit sprachlicher Fähigkeiten. Es liegt daher nahe, dass die immer häufiger auftretenden Sprach-, Lese- und Rechtschreibprobleme nur die Spitze des Eisbergs sind. Beispielsweise handelt es sich bei Leseschwäche (Dyslexie) nicht nur um einen Lesefehler. So müssen sich Kinder, die von Dyslexie betroffen sind, in höherem Maße auf grundlegende Fertigkeiten konzentrieren als Kinder, die nicht von Dyslexie betroffen sind. Sie sind z.B. stark auf visuelle Hinweise angewiesen, um das Gleichgewicht halten zu können.5
Dies erklärt, warum hier häufig ein Blick auf die motorischen Grundfertigkeiten, d.h. das Gleichgewichtssystem und die Tiefen- bzw. Eigenwahrnehmung, erforderlich ist. In diesem Zusammenhang lohnt sich bereits ein Blick auf die vorgeburtliche Zeit, denn: Alles Lernen des Kindes beginnt mit dem eigenen Körper. Und dieses Lernen beginnt bereits im Mutterleib. Schon hier lernt das Kind seinen eigenen, individuellen Körper kennen. Genauer müsste es an dieser Stelle heißen: Das Gehirn des Kindes lernt seinen individuellen Körper kennen. Neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung zeigen, dass sich die Hirnnetzwerke anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster organisieren. Vereinfacht bedeutet das, dass das Gehirn des Kindes bereits im Mutterleib geprägt wird – es erhält seine frühesten Bewegungssignale vom eigenen Körper und lernt auch weiterhin Bewegungen über den eigenen Körper. Somit findet das Erlernen von Bewegungen bereits vor der Geburt statt und ist immer ein individueller Prozess.6
Aufgrund dieser neurophysiologischen Erkenntnisse ist es wichtig, dass Kinder ausreichend Gelegenheit haben, ihren Körper kennenzulernen und Bewegungserfahrungen zu sammeln. Auch dieses Kennenlernen des eigenen Körpers wird bereits vor der Geburt erworben. Warum ist das so? Die Anregung des Gleichgewichtsmechanismus ist ein wesentlicher Bestandteil des embryonalen Wachstums. Ein kurzer Einblick in die Neurophysiologie hilft dies zu verstehen. Das Gleichgewichtsorgan selbst ist Teil des Innenohrs und dient zusammen mit den Augen, dem Oberflächen- und Tiefensinn der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Beschleunigungen und Lageänderungen aller Art werden vom Gleichgewichtsorgan wahrgenommen. Dadurch wird die Orientierung im Raum ermöglicht. Bereits um die neunte Schwangerschaftswoche bilden sich die Vestibulariskerne (Gleichgewichtskerne) im Hirnstamm. Diese nehmen schon in der zehnten bis elften Schwangerschaftswoche ihre Arbeit auf. Diese Kerne können als Schaltstellen für Gleichgewichtsinformationen verstanden werden. Die Aufgabe der Vestibulariskerne besteht darin, Anpassungsreaktionen auf Gleichgewichtsreize zu erzeugen, die durch die Bewegungen der Mutter hervorgerufen werden. Hier wird verständlich, dass schon die Bewegungsintensität und -sicherheit der Mutter entscheidend für die Entwicklung des Kindes ist. Sie haben einen Einfluss auf die Bewegungsfähigkeit und -erfahrungen des ungeborenen Kindes. Noch bevor das Gehirn Seh- und Hörreize verarbeiten kann, nimmt es die Gleichgewichtsreize wahr und reagiert darauf.
Die Vestibulariskerne empfangen ihrerseits die Signale des Gleichgewichtsorgans im Innenohr und leiten sie an das Rückenmark weiter, das an der Steuerung der dynamischen Körperhaltung beteiligt ist. Ebenso empfangen die Augenmuskelkerne Signale des Gleichgewichtsorgans zur Steuerung der Augenbewegungen. Auch aktivieren sensorische Impulse aus dem Gleichgewichtssystem die Formatio reticularis, eine netzartige Struktur in der Mitte des Hirnstamms. Diese Struktur reguliert den Wachheitsgrad. Daher sind Bewegungsaktivitäten wichtig, um wach und aufmerksam zu sein. Aus diesen Zusammenhängen wird deutlich, dass die Entwicklung des Kindes mit vielen anderen Bereichen in Wechselwirkung steht. So sind Gleichgewicht, Sehen und Hören sowie Fein- und Grobmotorik eng miteinander verknüpft und stehen in direktem Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung. Dieser Hintergrund erklärt, warum die Aktivität des Gleichgewichtssystems der Bezugsrahmen für alle unsere Erfahrungen ist. Lernen, Sprechen und Verhalten sind auf spezifische Weise mit Funktionen des Bewegungssystems und der Bewegungskontrolle verbunden. Eine gute Integration der Sinneswahrnehmung im Gehirn führt zu kognitiven Leistungen wie Konzentration, Gedächtnis, Sprache, Lesen, Schreiben und Selbstvertrauen.
Unsere Beziehung zur Erdanziehungskraft ist eine der elementarsten menschlichen Beziehungen. Diese Beziehung ist sogar noch ursprünglicher als die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Wenn die Beziehung zur Erde nicht sicher ist, können sich alle anderen Beziehungen nicht optimal entwickeln, so Jean Ayres. Für die Entwicklung des Hörens und Sehens ist die Gleichgewichtsaktivität eine zentrale Grundlage. Dies wiederum ist Voraussetzung für die Sprachentwicklung, für das Erlernen von Schreiben, Lesen und Rechnen. Über den Körper und die Sinne werden z.B. grundlegende Raumerfahrungen gemacht. Diese bilden die Grundlage für die Entwicklung der räumlichen Orientierung, für die Begriffsbildung und den Umgang mit Zahlen. Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit gelten als wesentliche Grundlagen für erfolgreiches Lernen, doch ohne Einbeziehung des Körpers ist dies nicht möglich. Ist der Körper unruhig, ist auch der Geist nicht wach und aufnahmefähig. So ist es nicht möglich, konzentriert und planvoll zu handeln.
Bewegung als erste Sprache des Kindes zu verstehen bedeutet, dass Lernen und Entwicklung auf sinnlichen Erfahrungen beruhen und dass diese Erfahrungen in den ersten Lebensjahren über den Körper erworben werden. Die Sinne sind die Antennen zur Aufnahme und Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt und dem eigenen Körper. Das Gleichgewichtssystem bildet dabei die zentrale Grundlage, da alle Sinneswahrnehmungen im Zusammenhang mit den Informationen des Gleichgewichtssystems verarbeitet werden.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, erfährt es sofort den Kontakt zur Erde durch die Wirkung der Schwerkraft auf seinen Körper. Kinder verbringen intuitiv viel Zeit damit, ihr Gleichgewichtssystem anzuregen und damit Bezug zur Schwerkraft zu entwickeln und sich mit und durch ihren Körper auszudrücken. Daher brauchen Kinder jeden Tag die Gelegenheit, aktive Bewegungserfahrungen zu machen. Bewegung stellt für Kinder Nahrung für das Gehirn dar, denn durch Bewegung und Interaktion mit der Umwelt entwickeln sich die sensorischen Systeme. All diese Aktionen finden im Schwerkraftfeld der Erde statt und das Kind lernt sich im Laufe seiner Entwicklung mit dieser Schwerkraft aufzurichten und schließlich frei im Raum zu gehen. So erhöht es den Grad seiner Selbstwirksamkeit.
Das „Gleichgewicht ist nicht etwas, was uns geschieht, es ist etwas, das wir tun“, meint Blythe. Was können nun Erwachsene, besonders Pädagoginnen und Pädagogen tun, damit diese Entwicklung möglichst reibungslos verläuft? Die Antwort ist einfach: den Kindern genügend Gelegenheit geben, ihren Körper kennenzulernen. Wie? Durch Spielen! Beim Spielen bewegen Kinder ihren Körper auf vielfältige Weise. Durch die Bewegung des ganzen Körpers entwickelt sich das Körperschema. Das Kind lernt, sich selbst im Verhältnis zum Raum wahrzunehmen. Wenn ein Baby durch den Raum krabbelt oder ein Kind einen Parcours bewältigt, arbeitet sein Körper als harmonische Einheit zusammen. Wenn ein Kind nicht die Erfahrung machen kann, seinen ganzen Körper einzusetzen, fehlen ihm Sinnesinformationen, die wichtig sind, damit sich sein Gehirn als Ganzes entwickeln kann.
Durch Bewegungsspiele und den Einsatz des ganzen Körpers, werden diese wichtigen Gleichgewichtsreize gegeben und die Grundlagen für Haltungskontrolle, Augenkoordination und Raumorientierung gelegt, welche die Basis für planvolles Handeln bilden. Daher suchen und brauchen Kinder in diesem Lebensabschnitt Körpererfahrungen. Neben einer stabilen Bindung ist die Freiheit, sich zu bewegen und zu spielen, eines der wichtigsten Geschenke, das einem Kind gemacht werden kann. Nach Blythe sind Kinder, die herumwirbeln und Purzelbäume schlagen, mit ihrer ersten Lektion beschäftigt, um die „Einsteins“ der Zukunft zu werden. Wenn wir den Kindern die Möglichkeit geben, sich in ihrer ersten Sprache, der Bewegung, auszudrücken und weiterzuentwickeln, dann entwickeln sich darauf aufbauend viele weitere Fähigkeiten und schließlich ihre gesamte Persönlichkeit. Die dringende Aufgabe unserer von Bewegungsmangel und Digitalisierung geprägten Zeit muss daher lauten: Den Körper wieder spüren lernen und den kindlichen Bewegungsdrang nicht unterdrücken, sondern bewusst für die Persönlichkeitsentfaltung des Kindes nutzen.
Quellen
1 Renate Zimmer, Toben macht schlau!: Bewegung statt Verkopfung, in: Verlag Herder, 4. Edition (Hrsg.), Freiburg: Herder 2004
2 Gerald Hüther, Sich bewegen lernen heißt fürs Leben lernen, in: Audio-CD von Vortrag am 20.10.2013, Veranstaltungsreihe „Erziehungsfallen 2013” in Linz, Müllheim-Baden: Auditorium Netzwerk Verlag für audiovisuelle Medien
3 Sally Goddard Blythe, Greifen und BeGreifen: Wie Lernen und Verhalten mit frühkindlichen Reflexen zusammenhängen, in: Team around the Child Journal 4(12), Freiburg: VAK 2011, 1-12
4 A. Jean Ayres, Bausteine der kindlichen Entwicklung: Sensorische Integration verstehen und anwenden, in: Springer, 6. Auflage (Hrsg.), Berlin Heidelberg: Springer Verlag 2016
5 Jamie L. Needle, Angela J. Fawcett & Roderick I. Nicolson, Balance and dyslexia: An investigation of adults’ abilities, in: European Journal of Cognitive Psychology 18(6), London: Routledge Taylor & Francis Group 2006
6 vgl. Gerald Hüther, Sich bewegen lernen heißt fürs Leben lernen, in: Audio-CD von Vortrag am 20.10.2013, Veranstaltungsreihe „Erziehungsfallen 2013”
Hol Dir Deinen Bildungsnachweis!
Hol Dir Deinen Bildungsnachweis!
Du hast den Artikel aufmerksam gelesen und möchtest Dir Dein Wissen zu diesem Thema bestätigen lassen? Logge Dich jetzt mit Deinen Campus+ Zugangsdaten ein und hole Dir nach bestandener Lernerfolgskontrolle Deinen Bildungsnachweis direkt zum Download.
Du hast noch keinen Zugang? Hole Dir jetzt CAMPUS+
Empty space, drag to resize
Zur Person
Annemarie Rasche ist studierte Bildungsforscherin, M.A, und Kindheitspädagogin B.A. Darüber hinaus ist sie Ergotherapeutin, Yogaübungsleiterin, Spiraldynamik® Fachkraft für Level Intermediate Körperarbeit, Trainerin für Achtsamkeit, Resilienz und Selbstmitgefühl und freiberufliche Referentin für Kindertageseinrichtungen. Aktuell befindet sie sich zusätzlich noch im Studium in interpersoneller Neurologie bei Daniel Siegel.
Annemarie Rasche ist studierte Bildungsforscherin, M.A, und Kindheitspädagogin B.A. Darüber hinaus ist sie Ergotherapeutin, Yogaübungsleiterin, Spiraldynamik® Fachkraft für Level Intermediate Körperarbeit, Trainerin für Achtsamkeit, Resilienz und Selbstmitgefühl und freiberufliche Referentin für Kindertageseinrichtungen. Aktuell befindet sie sich zusätzlich noch im Studium in interpersoneller Neurologie bei Daniel Siegel.
Empty space, drag to resize